ZEIT ONLINE | Geschwister : „Von der Schwester will ich, was ich bei der Mutter vermisse“
Schwestern sind kaum erforscht. Die Psychoanalytikerin Anita Dietrich-Neunkirchner erklärt, wie sie das Berufsleben prägen – und wie Eltern ihre Töchter stärken können.
Interview: Ileana Grabitz am 21. Dezember 2020, 18:30 Uhr
Foto: © brabanski/plainpicture
„Von der Schwester will ich, was ich bei der Mutter vermisse“
Schwestern werden unterschätzt – von der Psychologie, der Gesellschaft und manchmal sogar von der eigenen Familie. Weil die Beziehung zur Schwester aber Männer wie Frauen fürs Leben prägt, widmen wir diesem besonderen Verhältnis unseren Schwerpunkt „Hurra es ist eine Schwester“.
Die Wiener Psychoanalytikerin Anita Dietrich-Neunkirchner spricht angesichts der wenig erforschten Schwesterbeziehung von einer „Schwesternlücke“ in der Wissenschaft – und leistete selbst einen Beitrag, um diese Lücke zu füllen. Für ihr Buch Die symbolische Schwesternschaft untersuchte sie, inwieweit die Schwesternerfahrung das Verhalten von Frauen im späteren Berufsleben prägt.
ZEIT ONLINE: Frau Dietrich-Neunkirchner, neuen Studien zufolge sind Menschen, die eine Schwester haben, die glücklicheren Menschen. Stimmt das?
Anita Dietrich-Neunkirchner: Ja, wenn man sozialwissenschaftliche Studien zu Grunde legt, ist da vermutlich etwas dran – vor allem im Alter, wenn wir alle auf lang bestehende, vertraute Beziehungen zurückgeworfen werden. Wer im Alter noch Geschwister hat, ist meist im Vorteil, und wer eine Schwester hat, oft noch mehr: Einfach weil es in der Regel die Frauen sind, die Beziehungen im Blick behalten und pflegen. Das ist die sozialwissenschaftliche Perspektive. Psychoanalytisch betrachtet steckt in der Beziehung von Bruder zu Schwester oder von Schwester zu Schwester aber natürlich auch viel Konfliktpotenzial.
ZEIT ONLINE: Bleiben wir kurz bei der sozialwissenschaftlichen Perspektive: Das Bild von Frauen, die vor allem auf Harmonie und Beziehungspflege bedacht sind, entspricht ja einem alten Rollenverständnis. Hat sich mit der fortschreitenden Emanzipation da nichts getan?
Dietrich-Neunkirchner: Natürlich haben sich die Zeiten verändert und Frauen gelingt es zunehmend besser, sich in Bereichen jenseits der Beziehungspflege, etwa im Beruf, zu positionieren. Abgrenzung ist hier ein wichtiges Stichwort, und die will gelernt sein. Männer im Vergleich sind schon lange Künstler in beruflichen Netzwerken, einfach dadurch, dass sie bisher allein an der Spitze standen. Und auch das brüderliche Ideal, demzufolge man Krisen solidarisch gemeinsam durchsteht, gibt es schon lange. Denken Sie an das Ideal der Fraternité in der Französischen Revolution. Der Unterschied zu den Frauen ist, dass beim Netzwerken unter Männern in der Regel Konkurrenz und Rivalität nicht tabuisiert wird.
ZEIT ONLINE: Und als Psychoanalytikerin befragt: Ist es eher von Vor- oder Nachteil, eine Schwester zu haben?
Dietrich-Neunkirchner: Das lässt sich nicht verallgemeinern. Grundsätzlich gibt es den romantisch-idealisierenden Zugang zur Schwester, die Vorstellung von einer Partnerin, die immer da ist, wenn man sie braucht. Das ist aber ein Ideal, dem vor allem jene Menschen nachhängen, die selbst keine Schwester haben. Alle anderen wissen, dass in der Beziehung zur Schwester auch oft viel Neid und Rivalität im Spiel ist. Grundsätzlich muss man aber sagen: Die Schwesternbeziehung ist – ganz anders als die Beziehung zwischen Brüdern – viel zu wenig erforscht. Als Psychoanalytikerin spreche ich deswegen von einer „Schwesternlücke“.
ZEIT ONLINE: Warum gibt es eine Schwesternlücke? Können Sie das genauer erklären?
Dietrich-Neunkirchner: Nehmen wir Sigmund Freud, auf dem die Psychoanalyse ja bis heute in großen Teilen basiert. Freud hatte sieben Geschwister: einen jüngeren Bruder, der nach 17 Monaten verstarb, danach kamen fünf Schwestern, später wurde noch ein Bruder geboren. Als Sigmund acht Jahre alt war, hatte er also bereits fünf jüngere Schwestern! Ich – selbst Feministin und Freudianerin – habe mir sein gesamtes Werk angeschaut und geprüft, welche Rolle Schwesterbeziehungen spielen. Das Resultat war ernüchternd. Fast allein unter Schwestern: Sigmund Freud mit seinen Geschwistern, 1868 © API/Gamma- Raph/Getty Images
ZEIT ONLINE: Inwiefern?
Dietrich-Neunkirchner: Dazu liefere ich gern ein paar Zahlen. In Freuds Gesammelten Werken finden sich 300 Querverweise zum Vater, 200 zur Mutter, und immerhin noch 50 zu Geschwistern als Einheit. Mit der Rolle von Brüdern beschäftigt er sich 49-mal. Schwestern dagegen tauchen gerade mal 13-mal auf. Und wenn sie auftauchen, dann immer aus der Perspektive der Männer in der Familie, das horizontale Verhältnis von Schwestern untereinander oder von Schwester zu Bruder wird komplett ausgespart. Das fand ich so interessant wie irritierend, und umso mehr, weil Freud selbst so viele Schwestern hatte.
ZEIT ONLINE: Warum, glauben Sie, hat sich Freud so wenig damit beschäftigt?
Dietrich-Neunkirchner: Er war eben ein Kind seiner Zeit. 1856 geboren, 1939 gestorben, in der Zeit waren Frauen und Mädchen einfach weniger im Fokus, was man auch daran sieht, dass Sigmund Freud der Einzige aus seiner Familie war, der eine weiterführende Schule und danach eine Universität besuchen durfte.
ZEIT ONLINE: Nun sind seit dem Tod Freuds mehr als 80 Jahre vergangen. Genug Zeit, um die Schwesternlücke zu füllen, oder?
Dietrich-Neunkirchner: Theoretisch schon, aber tatsächlich ist die horizontale Beziehung von Schwester zu Schwester oder von Schwester zu Bruder aus psychoanalytischer Sicht weitgehend unerforscht. In der US-amerikanischen Fachliteratur und vereinzelt im deutschen Sprachraum gibt es immerhin ein paar Untersuchungen zur Schwesternbeziehung in der Adoleszenz, viel ist es aber bis heute nicht.
ZEIT ONLINE: Was bedeutet das für Ihre psychoanalytische Arbeit heute? Fehlt Ihnen nicht das nötige Instrumentarium, um Frauen, die unter schwierigen Schwesternbeziehungen leiden, Rat zu geben?
Dietrich-Neunkirchner: Durch meine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Schwesternthema bin ich mittlerweile sensibilisierter. So habe ich herausgefunden, dass die Beziehung von Schwestern untereinander immer auch mitgefärbt wird durch das innere Bild von einer weiteren Frau in der Familie, nämlich der Mutter. Schwester und Mutter sind gleich im Geschlecht. Dies begünstigt, dass sich Wünsche oder Konflikte, die eigentlich an die Mutter adressiert sind, im Schwesterlichen widerspiegeln. Aber zumeist unbewusst. So möchte ich etwa von der Schwester etwas, was ich in der Beziehung zur Mutter vermisst habe oder mit dieser nicht ausleben konnte. Diese Vermischung betrifft übrigens nicht nur leibliche Schwesternbeziehungen, sondern ist ebenso präsent im Berufsleben – wenn ich mit Frauen auf gleicher Augenhöhe arbeite.
ZEIT ONLINE: Sind Beziehungen zwischen Bruder und Schwester einfacher als die zwischen Schwester und Schwester? Ich selbst habe zwei Brüder, einen älteren, einen jüngeren, und keine Schwester – und wähnte mich glücklich: Statt lästiger Vergleiche mit einem anderen Mädchen hatte ich einen großen Bruder, der mich, wenn es gut lief – ich weiß, es ist ein Klischee – beschützte und zu seinen coolen Freunden mitnahm.
Dietrich-Neunkirchner: Sie hatten offenbar Glück, weil sie von ihren Brüdern akzeptiert und sogar mit hineingenommen wurden in die Brüdergemeinschaft. Deswegen sind Bruder- Schwester-Beziehungen aber auf keinen Fall grundsätzlich weniger kompliziert. Und was Sie nicht vergessen dürfen: Ihre positive Erfahrung als Schwester haben sie gemacht, weil ihre Brüder sie gewissermaßen aufgewertet haben.
ZEIT ONLINE: Demnach wären es immer Männer, die in der Familie die Rollen definieren?
Dietrich-Neunkirchner: Nein, das hängt zunächst vom Schwestern- und Frauenbild in der Familie ab und auch vom Alter und der Reihenfolge der Geschwister. Als jüngere Schwester eines Bruders wird mein Schwesternbild sehr stark von ihm definiert. Bin ich die Ältere, werde ich meine Rollendefinition eher durch meine eigene Brille vornehmen. Es kommen aber natürlich noch die Eltern mit ihren eigenen Erfahrungen von Geschwisterlichkeit hinzu. Wenn ein Vater eine gute Beziehung zu der Schwester hatte, die Mutter eine schlechte Beziehung zu ihrer Schwester, dann werden diese Erfahrungen auch übertragen, vor allem unbewusst.
„Auch moderne Väter übertragen Rollenvorbilder auf ihre Töchter“
ZEIT ONLINE: Erwarten Eltern von Töchtern und Schwestern ein größeres Harmoniestreben als von ihren Söhnen und Brüdern?
Dietrich-Neunkirchner: Das hängt stark von der eigenen Sozialisation ab, was die Eltern von Männern und Frauen allgemein erwarten. Die geschlechtsspezifische Sozialisation beginnt mit Erwartungen und Zuschreibungen der Mutter an ihr Baby.
ZEIT ONLINE: Schon wieder ist also die Mutter schuld! Warum?
Dietrich-Neunkirchner: Na ja, mit einer Schuldzuweisung tue ich mich als Psychoanalytikerin schwer. Es geht um Wünsche nach Nähe und nach Abgrenzung. Zwischen der Mutter und ihrer Babytochter werden typische Nähe- und Distanzwünsche anders gespürt und verhandelt, als es die Mutter mit ihrem Babysohn etwa macht. Der kleine Säuglingsbub unterscheidet sich aufgrund seines Geschlechts schon von der Mutter, es ist von vorneherein mehr Differenz, mehr Anderssein da. Vielleicht weniger verschmelzende Intimität, aber auch mehr Luft und Raum fürs Aggressive. Die unbewussten Bilder der Mutter zum Sohn sind andere und in der Regel ist sie die erste Bezugsperson.
ZEIT ONLINE: Das heißt, in einer modernen Familie, in der sich Vater und Mutter die Kindererziehung paritätisch aufteilen, ist der Vater genauso einflussreich?
Dietrich-Neunkirchner: Genauso einflussreich würde ich nicht sagen, nein. Wir leben in einem Patriarchat im Umbruch, aber eben immer noch in einem Patriarchat. Auch die aufgeklärten Väter haben ihre eigenen Rollenbilder, die noch sehr männlich geprägt sind von der Generation davor und auf die Töchter übertragen werden. Und selbst wenn sich beide Elternteile paritätisch einbringen, ist die Mutter in vielen Fällen dann doch einfach die erste Bezugsperson: schon allein, weil sie stillt oder die Flasche gibt, in den ersten Lebensmonaten oft rein physisch näher dran ist an dem Kind.
ZEIT ONLINE: Stimmt es, dass Mädchen, also die Töchter in einer Familie, öfter als Söhne die Aufgabe des Kümmerns übernehmen? Sich um den Zusammenhalt bemühen, sich für die Eltern stärker verantwortlich zeigen, gerade wenn sie älter und hilfebedürftig werden?
Dietrich-Neunkirchner: Verallgemeinern kann man auch hier nicht natürlich, aber ja: Tendenziell stimmt das – und dies lässt sich gut mit der Nischentheorie von Frank Sulloway erklären. Ihm zufolge geht es bei Geschwistern immer darum, die maximale Aufmerksamkeit der Eltern zu bekommen. Kriege ich sie durch Angepasstheit? Durch maximales Auffallen? Oder durch die besten Leistungen? Da spielen dann natürlich auch Rollenbilder mit hinein. Wenn das Ideal der Eltern ist, dass ein Mädchen sich selbst zurücknimmt und sich um alle kümmert, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Tochter diese Rolle auch annimmt.
ZEIT ONLINE: Aber moderne Eltern bemühen sich doch sehr, nicht in die Genderfalle zu tappen: Mädchen bekommen Bagger und Autos geschenkt, Jungs kochen und tragen Röcke.
Dietrich-Neunkirchner: Es ist viel komplizierter, denn die Nischentheorie spart zum Beispiel das Unbewusste weitgehend aus. Die Prägung fängt in der Tat schon viel früher an, als sich ein Kind seine Nische suchen kann. Ein Beispiel: Viele Eltern lassen sich lange vor der Geburt das Geschlecht ihres Kindes sagen und da fängt es schon an. Egal ob Junge oder Mädchen: Die Eltern haben von dem Zeitpunkt an bereits bestimmte Bilder im Kopf, und das Kind spürt das. Auch die Art und Weise, wie ich das Kind berühre, wenn es geboren ist, ob ich es stille, ob ich neben dem Flaschegeben noch am Handy bin: Das alles sind ja Signale an das Kind, die auf das Rollenverständnis einzahlen. Selbst wenn mir meine Eltern als Mädchen das wilde Pippi-Langstrumpf-Leben als Vorbild hinhalten, können sie unbewusst ganz andere, viel konservativere Signale aussenden. Das darf man nicht vergessen.
ZEIT ONLINE: Kommen wir zurück zu der Schwesterbeziehung: Sind Konflikte zwischen Schwestern andere als zwischen Brüdern?
Dietrich-Neunkirchner: Die Triebe sind immer die gleichen. Es geht immer um das Wechselspiel von Aggression und Zuneigung, von Abgrenzung und Zärtlichkeit. Was man aber bis ins Erwachsenenleben beobachten kann: Frauen haben Schuldgefühle, wenn es dann mal wirklich aggressiv wurde, Männer eher nicht.
ZEIT ONLINE: Warum haben Frauen diese Schuldgefühle?
Dietrich-Neunkirchner: Aufgrund der Sozialisation, die durch bewusste und unbewusste Rollenzuschreibungen erfolgt.
„Fürchtet euch nicht vor der Aggression eurer Töchter“
ZEIT ONLINE: Wie kann man als Elternteil die Töchter so stärken, dass sie in Konflikten selbstbewusster werden? Und: Sollte man das überhaupt tun?
Dietrich-Neunkirchner: Natürlich sollte man das tun. Dafür muss man zuallererst lernen, sich nicht vor der Aggression der Mädchen zu fürchten. Gerade Mütter tendieren oft dazu, bei ihren Töchtern den Wert des Redens und Miteinanderausdiskutierens als wichtiger zu erachten als den Mut zur Auseinandersetzung. Stattdessen müssen sie verstehen, dass die Aggression unter den Kindern nicht tödlich ist. Wenn auch Mädchen erfahren, dass sie sich streiten dürfen, ohne dass die Grundfeste der Beziehung erschüttert wird, ist viel gewonnen.
ZEIT ONLINE: Nur streiten oder auch prügeln?
Dietrich-Neunkirchner: Je nach Familiensystem, das müssen die Eltern entscheiden. Ich finde ja, dass jede und jeder sich wehren sollte. Wer sich nicht wehrt, läuft Gefahr, gemobbt zu werden. Gut ist, wenn Eltern keinen Unterschied machen zwischen Jungs und Mädchen. Wenn es okay ist, dass sich zwei Brüder mal gegenseitig knuffen und schubsen, dann muss das auch für Mädchen okay sein. Sichtbare Aggression ist auf jeden Fall immer besser als unsichtbare Aggression, wozu Frauen oft mehr tendieren.
ZEIT ONLINE: Sie haben sich in Ihrer Studie damit beschäftigt, inwieweit die Schwesternerfahrung das Verhalten von Frauen im späteren Berufsleben prägt. Wie groß ist der Einfluss tatsächlich?
Dietrich-Neunkirchner: Gravierend. Um die Übertragung der Schwesterbeziehungen zu studieren, habe ich mir im Rahmen einer qualitativen Studie sehr intensiv vier Frauenpaare angeschaut, die seit Jahren sehr eng und sehr erfolgreich zusammenarbeiten, und zwar solche, die gemeinsam ein Unternehmen leiten. Meine Frage lautete: Wenn Frauen auf Augenhöhe schon lange erfolgreich miteinander arbeiten, woran liegt es, dass es so gut geht?
ZEIT ONLINE: Und was waren Ihre Erkenntnisse?
Dietrich-Neunkirchner: Allen vier Frauenpaaren war zum Beispiel gemein, dass sie einander lange kannten, bevor sie sich entschlossen, ein Unternehmen zu leiten. Alle pflegten eine, wie ich es nenne, befruchtende Gemeinsamkeit, nahmen sich Zeit für intensive Gespräche, auch über das fachlich Notwendige hinaus. Neid konnte gut ausbalanciert werden und sie brachten eine große Wertschätzung gegenüber den Erfolgen der anderen mit. Auch eine gewisse Fürsorglichkeit im Berufsalltag war selbstverständlich, ebenso wie der Genuss eines Gefühls von Vertrauen, Intimität und Nähe. Das ist ein großer Unterschied zu Männern, die im Berufsleben auf gleicher Ebene zusammenarbeiten, aber in der Regel viel distanzierter und pragmatischer sind. Das für mich Interessanteste aber war: Alle Frauen haben gemeinsam, dass sie sich in ihrer Kindheit ausgeschlossen fühlten als Schwester und dass diese Leerstelle im beruflichen Kontext dann positiv erfüllt werden konnte. Sie erleben also jeweils etwas mit ihrer Berufspartnerin, das ihnen in der Kindheit versagt blieb.
ZEIT ONLINE: Heißt das im Umkehrschluss, dass Frauen, die sich als Schwester gut aufgehoben fühlten, weniger gut harmonieren würden in einer weiblichen Doppelspitze?
Dietrich-Neunkirchner: Diese Schlussfolgerung wäre zu extrem, aber ich würde schon sagen: Wer als Kind nicht so einen Leidensdruck erfährt, bringt tendenziell weniger Energie auf, sich beruflich in eine solche Nähe mit einer Frau zu begeben.
ZEIT ONLINE: Gibt es auch Bereiche, wo uns die Schwesternschaft belastet im Berufsleben?
Dietrich-Neunkirchner: Ich denke schon. Wenn es sehr viel Konkurrenz und Neid gibt in einem Kolleginnenkreis, sind Frauen, die selbst eine neidvolle, rivalisierende Beziehung zu ihrer Schwester hatten, womöglich geneigt, dieses Verhalten auf das Verhältnis zu den Kolleginnen zu übertragen. Das wäre dann die sogenannte Stutenbissigkeit.
ZEIT ONLINE: Und wie steht es um das Verhältnis von Mitarbeiterin zu Chefin? Ist das auch geprägt von der Rolle, die eine Frau im Geschwistergefüge eingenommen hat?
Dietrich-Neunkirchner: Nur bedingt, was dort zum Tragen kommt, sind – wenn überhaupt – Übertragungen aus der Tochter-Mutter-Beziehung, denn hier geht es ja nicht um eine Beziehung auf Augenhöhe. Das Verhältnis von Chefin zu Mitarbeiterin ist aber in der Tat kompliziert. Abgesehen von inhaltlichen Themen wird bei der Chefin unbewusst der konflikthafte Wunsch aktiviert, mit der Mitarbeiterin in eine töchterlich-verschmelzende Innigkeit einzutauchen. Seitens der Mitarbeiterin wiederum der Wunsch nach einer Mutter, die immer gut und verständnisvoll wäre und die einen versorgt. Je nach Person kann es einerseits schwierig sein, harte Entscheidungen zu treffen, andererseits mit harten Ansagen zu leben.
ZEIT ONLINE: Prägt die Schwesterrolle denn auch das Verhältnis zu männlichen Kollegen?
Dietrich-Neunkirchner: Ja. Denn die jeweilige Frau wird mit ihrem inneren Bild von Schwesterlichkeit auf die männlichen Kollegen zugehen. Umgekehrt agieren auch die männlichen Kollegen aus ihrer spezifischen unbewussten Bruderrolle heraus auf diese schwesterliche Frau.
ZEIT ONLINE: Wenn Sie es in wenigen Worten sagen müssten: Was unterscheidet das Bruder-Schwester-Verhältnis vom Verhältnis zwischen Schwester und Schwester?
Dietrich-Neunkirchner: Differenz versus Gleichheit – beides birgt Konfliktpotenzial in sich, aber eröffnet auch genussvolle Bindungserfahrungen.
ZEIT ONLINE: Um den Bogen zur Eingangsfrage zu schlagen: Sind Frauen, die Schwestern sind, auch die glücklicheren Frauen?
Dietrich-Neunkirchner: Das weiß ich nicht. Ich für meinen Teil, als Schwester eines Bruders, kann jedoch die Frage so beantworten: Viele Glücksmomente wurden mir durch schwesterliche Verbindungen ermöglicht, etwa im feministischen Engagement. Denn auch, wenn wir keine leiblichen Schwestern haben, so können wir in einer gleichrangigen Beziehung mit Frauen sublimiert eine symbolische Schwesternschaft eingehen.
Link: https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2020-12/geschwister
Anita Dietrich-Neunkirchner ist Klinische Psychologin, Supervisorin und Psychoanalytikerin in Wien. Darüber hinaus ist sie als Universitätslektorin und Leiterin der Gender-Study-Group an der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien tätig. In ihrem 2019 erschienenen Buch „Symbolische Schwesternschaft“ (Psychosozial- verlag) befasst sie sich mit der weiblichen Beziehungskultur und möglichen Übertragungen im Berufsleben.
https://www.sfu.ac.at/de/person/mag-a-dr-in-anita-dietrich-neunkirchner/
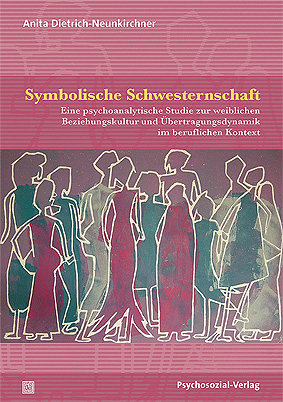
Anita Dietrich-Neunkirchner:
„Symbolische Schwesternschaft“
Eine psychoanalytische Studie zur weiblichen Beziehungskultur und Übertragungsdynamik im beruflichen Kontext
Buchreihe: Forschung Psychosozial
Verlag: Psychosozial-Verlag
ISBN-13: 978-3-8379-2931-7, Bestell-Nr.: 2931
Link zum Verlag

